Väter, raus aus der Opferrolle!

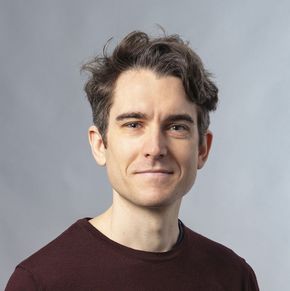
Wie die Kinder- und Jugendpsychiatrie getrennt lebenden Vätern hilft, die Probleme mit dem Besuchsrecht haben.
Probleme mit dem Besuchsrecht betreffen noch immer meistens die Väter. Dabei erleben diese die Ex-Partnerin und Mutter des gemeinsamen Kindes mitunter als „übermächtig“ und „dominant“. Selbst erleben sie sich – vielleicht – als "ausgeliefert", "schwach" oder "machtlos". Es ist verständlich, dass einzelne Väter auf diese "Bedrohung" erst mal mit Wut und Gegenwehr reagieren.
Happige Vorwürfe – verhärtete Fronten
Dabei kann es zu einer Serie von Eskalationen kommen, in denen auch juristische Schritte unternommen werden. Diese sind meistens sehr lange, sehr teuer, emotional belastend und führen zu verhärteten Fronten. In Einzelfällen wird von der Ex-Partnerin gar ein sexueller Missbrauch des Kindes durch den Vater nicht mehr ausgeschlossen. Aus therapeutischer Sicht offenbart ein derartiger Eskalationsprozess vor allem das gestörte Vertrauensverhältnis und das grosse Misstrauen der ehemaligen Partner zueinander.

Kinder im Loyalitätskonflikt
Wie geht es dem gemeinsamen Kind in dieser Situation? Und wie soll es ihm unter dieser angespannten Konfliktsituation gelingen, gerne und aus freien Stücken zum Vater zu gehen? Der in diesem Zusammenhang immer wieder ins Feld geführte Loyalitätskonflikt für die Kinder spielt zur Beantwortung dieser Frage eine wesentliche Rolle.
Durch eine Trennung verändert sich die Familiensituation für die Kinder, was für sie eine grosse Herausforderung ist. Wenn das innerfamiliäre Konfliktniveau sehr hoch ist, kann das die vorhandene Resilienz beim Kind in seiner Anpassungsleistung an die neue Familiensituation überstrapazieren. Die Fähigkeit der Kinder, mit Ambivalenzen umzugehen, ist noch nicht stark ausgeprägt. Darum müssen sie diese emotionale Pattsituation – ein Loyalitätskonflikt – lösen. Das machen sie, indem sie sich mit einem Elternteil verbünden.
Im Versuch der Anpassung an die neue Familiensituation können Kinder in einen Loyalitätskonflikt geraten.
Abhängigkeit und Distanz
In der Regel lösen sie den Loyalitätskonflikt zu Gunsten jener Person, von der sie sich situativ gerade abhängiger fühlen und distanzieren sich vom anderen Elternteil. Diese Abhängigkeit bezieht sich sowohl auf die physischen wie emotionalen Grundbedürfnisse. Die Kinder befürchten dann unterbewusst, durch den Besuch oder Kontakt zum Vater die Mutter zu verraten und diese eventuell zu verlieren – oder umgekehrt.
Aufgrund dieses Loyalitätskonflikts lehnen die Kinder den Kontakt zum anderen Elternteil ab und gehen mit der Mutter (oder dem Vater) eine Allianz ein. Da die meisten Kinder nach der Trennung häufiger grösstenteils oder ganz von den Müttern beaufsichtigt werden, trifft diese Ablehnung oder Distanzierung immer noch meistens die Väter.
Konfliktniveau zwischen den Eltern senken
Das Problem des Besuchsrechts lässt sich darum lösen, indem das Konfliktniveau zwischen den Eltern möglichst gesenkt und gering gehalten wird, um den Kindern den Übergang vom "Mami-Planeten" zum "Papi-Planeten" und umgekehrt zu erleichtern. Doch wie können wir die Väter dafür gewinnen, ihren Kampf-Modus zu beenden und sich dafür einzusetzen, das familiäre Konfliktniveau zu senken?
Behördenentscheide allein nützen wenig, wenn…
Viele Väter haben zu Beginn des Konflikts häufig die Vorstellung, mit Hilfe juristischer Schritte oder durch Entscheidungen der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) oder vom Gericht endlich Recht zu erhalten. Diese Schritte sind legitim und zu respektieren. Sie scheinen aber auch durch eine eigene Unsicherheit begründet. Denn was nützt es, wenn die Väter zwar ihr Besuchsrecht nochmals bestätigt erhalten, dieses aber nicht umgesetzt werden kann?
Kinder- und Jugendpsychiatrie kann helfen
Hier setzen wir in der Kinder- und Jugendpsychiatrie mit unseren Beratungsgesprächen an: Das geringe Vertrauen der Elternteile zueinander und die Erarbeitung einer "neuen Elternebene" sind darum die übergeordneten Therapieziele unserer ambulanten Gespräche – sowohl mit den Vätern alleine, als auch mit beiden Elternteilen gemeinsam.
Im Einzelsetting hören wir als erstes den Vätern mit einer neutralen und offenen Haltung zu. Wir versuchen, ihre Sichtweise der Problematik genau zu erfassen, ein gemeinsames Erklärungsmodell zu entwickeln und suchen nach ersten Ansatzpunkten, bei denen Verhaltensmodifikationen bei den Vätern möglich sind.
Perspektivenwechsel bei den Vätern
Anschliessend kommt der therapeutisch herausfordernde Teil, nämlich einen Perspektivwechsel bei den Vätern anzustossen. Dabei sollen die Väter ein gewisses Verständnis und vielleicht sogar eine Wertschätzung für die Mutter im Umgang mit dem Kind entwickeln, ohne dass sie sich durch uns Therapeutinnen und Therapeuten missverstanden oder gar angegriffen fühlen. Beim Perspektivwechsel geht es in erster Linie darum, dass der Vater Verhaltensweisen der Mutter als dem Kind dienlich und hilfreich erkennen kann.

Die Väter können sich von einer Haltung des Rückzugs und der Ohnmacht hin zu einer zugewandten, aktiven und auch starken Haltung entwickeln.
Verhaltensstrategien für Präsenz beim Kind
Parallel zu diesem Annäherungsprozess gegenüber der Mutter erarbeiten wir mit dem Vater Verhaltensstrategien, wie er sich im Leben des Kindes anderweitig präsent zeigen kann, ohne mit dem Kind direkt in Form des Besuchsrechts im Kontakt zu stehen. Denn hier können sich die Väter von einer Haltung des Rückzugs und der Ohnmacht (z.B.: "Die Mutter informiert mich nicht!" oder „Sie entfremdet mir mein Kind!“) hin zu einer zugewandten, aktiven und auch starken Haltung als Vater entwickeln.
Kurz gesagt: Raus aus der Opferrolle hin zu einer tatkräftigen, wirksamen und selbstbewussten väterlichen Einstellung. Der Vater kann zum Beispiel sich selbständig um Informationen von der Schule kümmern, Kontakt mit den behandelnden Ärzten aufnehmen, Briefe oder Postkarten an das Kind schreiben und ihm Geschenke übergeben (lassen). Weiter ist auch die Bedeutung des Vaters für die finanzielle Fürsorge gegenüber dem Kind deutlich hervorzuheben.
Aufbau von Vertrauen
Parallel wird in unseren Gesprächen mit beiden Elternteilen nach Möglichkeit gesucht, wie Vertrauen aufgebaut werden kann. Hilfreich und vielversprechend für Fortschritte ist es, wenn der Vater der Mutter für ihre Leistungen in der Vergangenheit – z.B. in der Betreuung und Erziehung der Kinder – Anerkennung schenkt. Natürlich liegen oft grundsätzlich unterschiedliche Ansichten vor. Aber meistens gelingt es uns, zusammen mit den Vätern noch so kleine positive Handlungen der Mutter zu finden. Insbesondere eine Entschuldigung des Vaters für allenfalls begangene Fehltritte oder verletzende Verhaltensweisen können eine tendenziell positive und hinzuwendende Haltung bei der Mutter bewirken.
Das Bild über den Vater ändern
Mit Hilfe solcher Äusserungen kann die Expartnerin dazu eingeladen werden, ihr verinnerlichtes Bild über den Vater zu ergänzen und vielleicht sogar zu modifizieren. Die Möglichkeit entsteht, den ehemaligen Partner mit all seinem vergangenen, wahrscheinlich auch verletzenden Verhalten neu kennenzulernen. Der Wunsch des Vaters für mehr Kontakt mit den Kindern soll von ihm mehrfach und klar formuliert werden.
Gleichzeitig soll der Vater mitteilen, dass er der Mutter nichts wegnehmen möchte. Es ist in diesen Gesprächen essenziell, auf allfällige Bedrohungsgefühle der Mutter einzugehen und mit Hilfe gemeinsamer Lösungsideen das Vertrauen der Eltern zueinander zu entwickeln. Mit Hilfe dieses parallelen Vorgehens von Einzel- und Elterngesprächen soll auf eine Reduktion des Konfliktniveaus hingearbeitet werden, sodass das gemeinsame Kind möglichst unbelastet vom einen "Planeten" um anderen wechseln kann.
Der Wunsch des Vaters für mehr Kontakt mit den Kindern soll von ihm mehrfach und klar formuliert werden.
Möglichst früh eine Beziehung zum Kind aufbauen
Und hier noch einen Rat zur Prävention an die Väter: Diese sollen unbedingt auch nach der Trennung weiter ihre Erziehungs- und Modellfunktion für ihre Kinder wahrnehmen. Es lohnt sich darum als Vater, früh mit den Kindern eine Beziehung aufzubauen. Dabei geht es in erster Linie um die Qualität, die der Vater mit seinem Kind herstellen kann.
Insbesondere auf diese Beziehung zum Kind lässt sich im Falle einer Trennung das Besuchsrecht des Vaters aufbauen. Wenn es keine Beziehung gibt, kann diese nur schwer aufgebaut werden. Erst recht, wenn der Konflikt unter den Eltern sehr stark ist.




